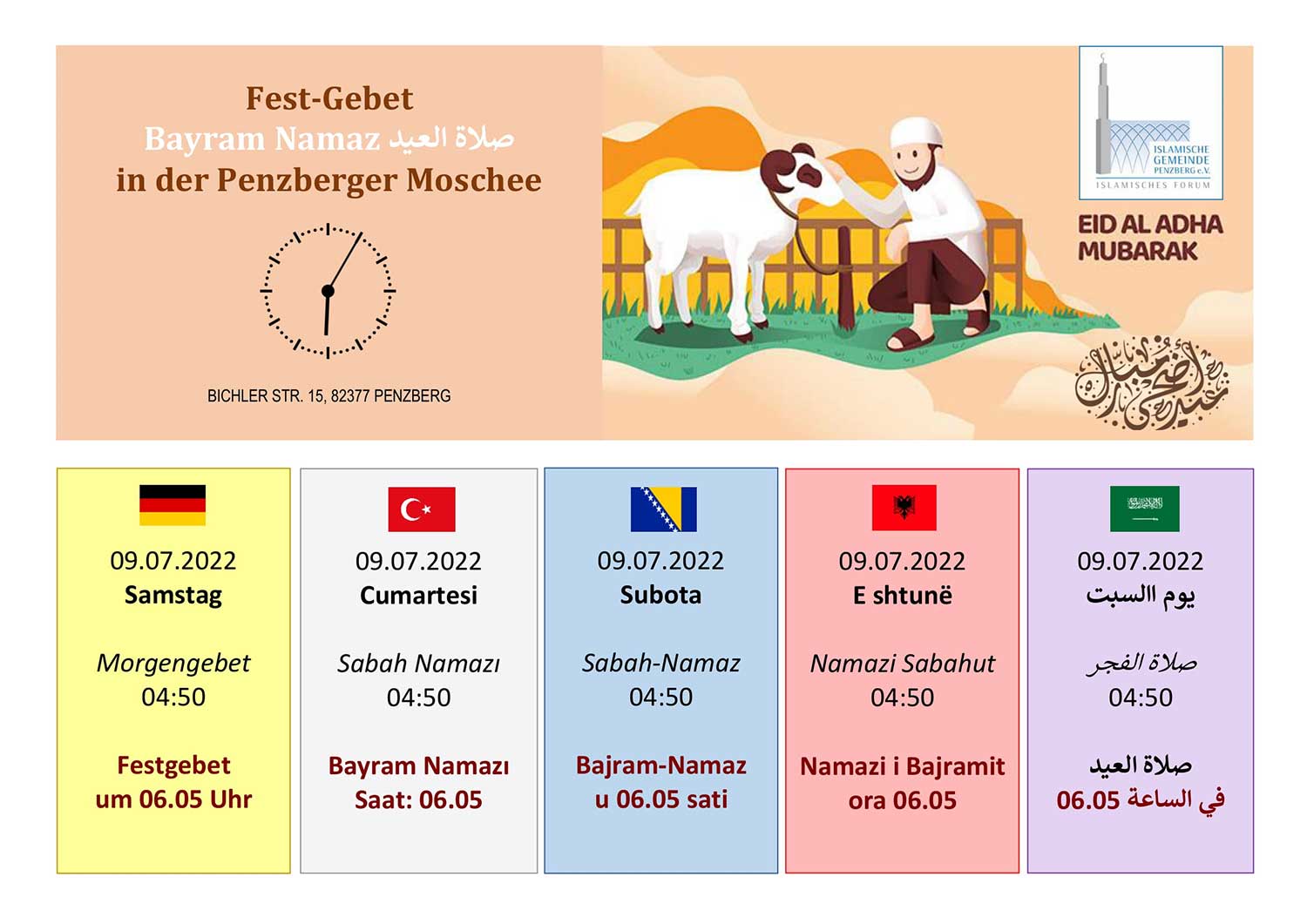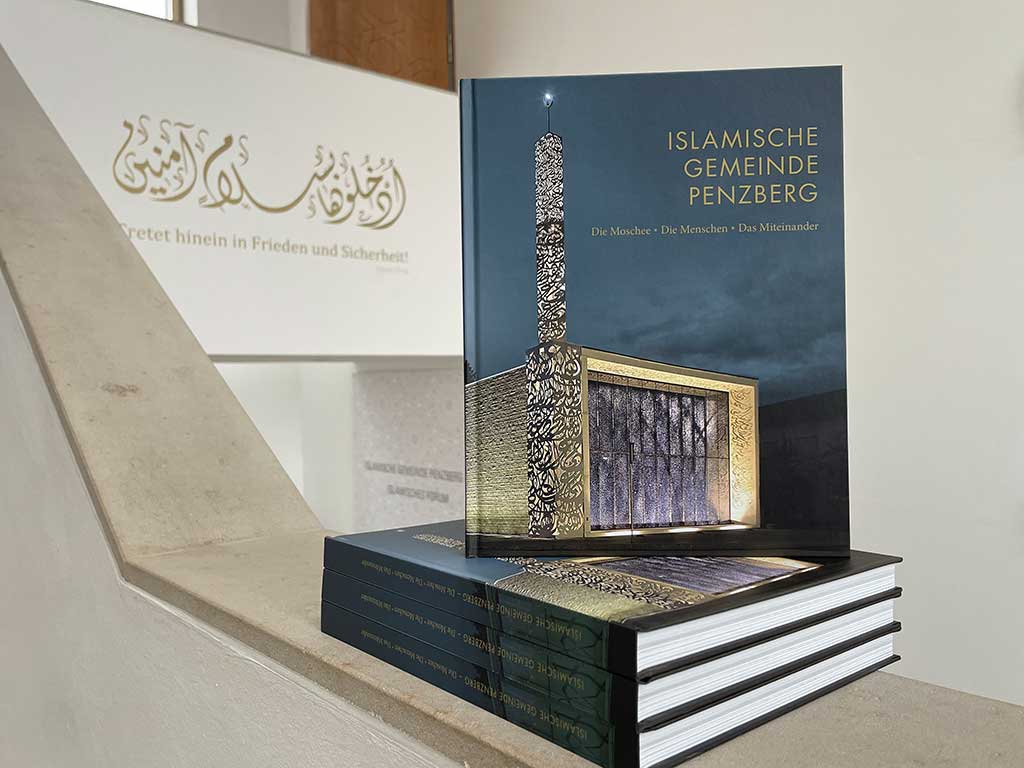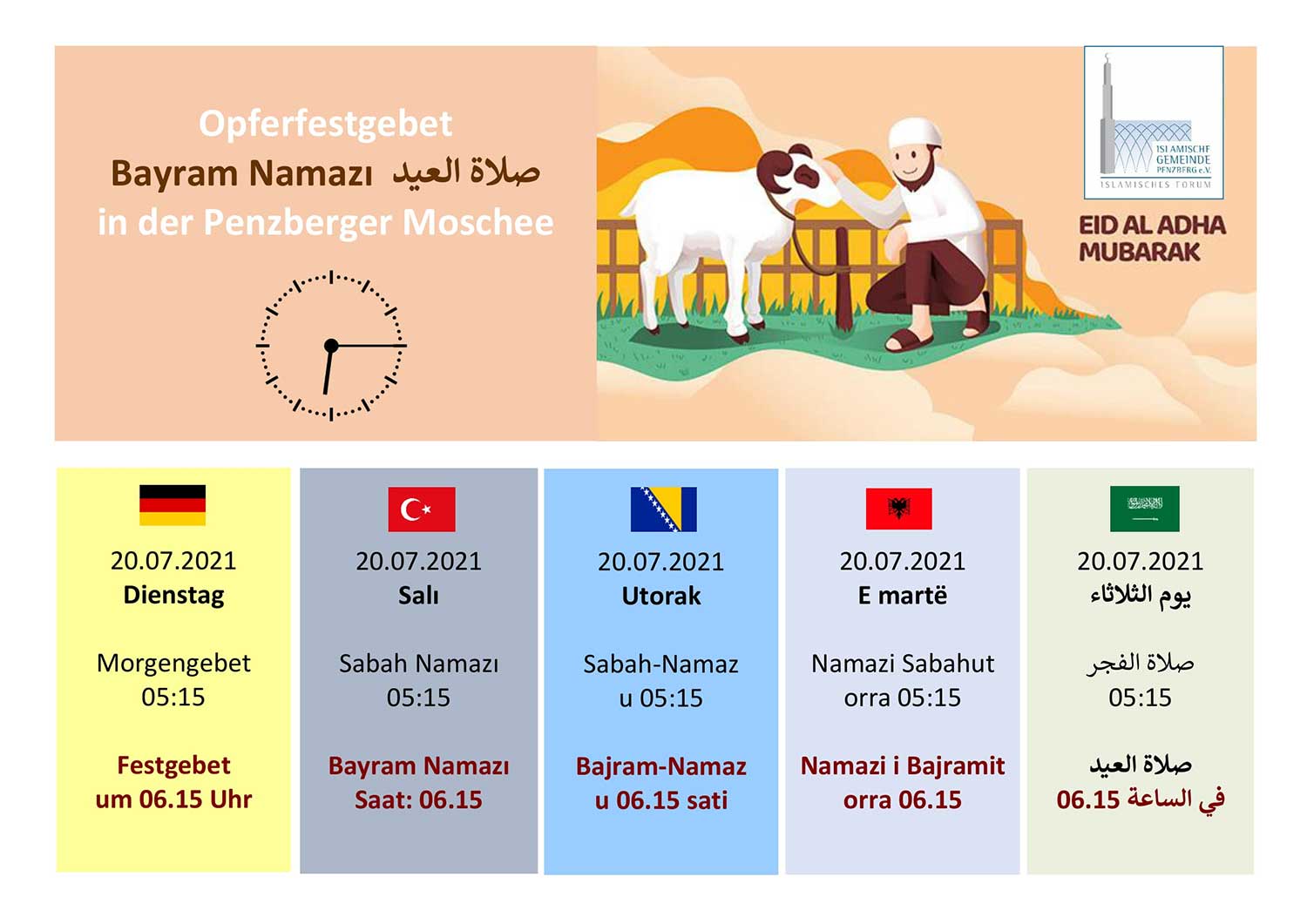Publikationen
Muslimische Denker befürworten die Demokratie

Die grundlegenden Quellen des Islam, der Koran und die Sunna, beziehen sich nicht direkt auf ein Staatssystem. Alles, was diese beiden Quellen zur Verwaltung und Administration des Staates beinhalten, sind die Werte der Gerechtigkeit, Kompetenz, Beratung sowie die Werte einer fundamentalen politischen Moral im Dienste der Staatsgeschäfte. All diese Werte richten sich auf das Ziel, die allgemeinen Fragen der Gesellschaft zu lösen, die auch die universellen Fragen der Menschheit sind. Dies muss auch der Standpunkt sein, den ein Staat einnimmt, ohne sich in religiöse Angelegenheiten einzumischen, die eher den individuellen Bereich der Gläubigen regeln. So wie es keinen Staat der Religion geben darf, so ist auch eine Religion des Staates unzulässig. Der Islam sieht eine Trennung bzw. Kooperation zwischen Religion und Staat vor, also einen »Kooperationsstaat« auf der Basis von Werten. Daher ist der »Islamismus« in der in Europa so bezeichneten Form, also der Anspruch auf einen sogenannten Gottesstaat, mit dem Islam unvereinbar.
Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand ein neuer islamischer Diskurs, der sich in religiösen Fragen rationaler und gemäßigter, in politischen Fragen demokratischer zeigte. So traten innovative muslimische Denker auf; sie konzentrierten sich auf die Gerechtigkeit als denjenigen Wert, der im Koran am stärksten hervorgehoben wird, sie aktivierten die lange verworfene Methode der freien Urteilsfindung (idschtihad) wieder und zogen Parallelen zwischen den politischen Theorien des Islam und dem demokratischen System des Westens, um ein neues Verständnis vom Islam zu entwickeln. Diese politischen Theologen setzten sich mit der Geschichte kritisch auseinander und verurteilten die Glaubenshaltung der radikalen, fundamentalistischen und ultrakonservativen Kreise, denen sie einen Missbrauch des Islam vorwarfen. Dabei kristallisierte sich ein neuer Ansatz heraus, der die Angelegenheiten des Glaubens und der Politik nicht miteinander vermengt, der sie aber auch nicht voneinander isoliert.
Die intellektuellen Wortführer dieser Richtung stammten aus verschiedenen Ländern und ihre Ansichten bezüglich des Verhältnisses zwischen Glauben und Politik bildeten das philosophische Fundament, auf dem der künftige »politische Islam« beruhen sollte. Die Grundlage und das Zentrum dieser Philosophie waren »Freiheit, Menschenrechte und demokratische Werte«. Sie gingen dabei sowohl zum Theokratismus als auch zu einem ultra-laizistischen Staatsverständnis auf Distanz und schlugen einen mittleren Weg vor. Lassen Sie uns einige dieser Theoretiker als Beispiel erwähnen:
Fazlur Rahman (gest. 1988) aus Pakistan fasst seine Ansichten so zusammen: »Der Koran ist kein juristisches Buch, sondern ein Buch der Moral und Ratschläge. Die juristischen Regeln im Koran, deren Zahl ohnehin gering ist, sind als Beispiele angeführt, sind also nicht verbindlich für alle Zeiten. Was absolut verbindlich ist, sind die hohen religiös-ethischen Werte und die Vorschriften über die Anbetung. Die Demokratie ist diejenige Regierungsform, die dem koranischen Prinzip der Volksberatung (schura) am nächsten kommt.
Bei dieser Feststellung handelt es sich nicht um die Legitimierung eines westlichen Begriffs durch den Koran, sondern um eine Wiederentdeckung. Im Islam ist das Volk das fundamental Entscheidende. Im Staat haben Muslime und Nicht-Muslime die gleichen Rechte. Wenn der Islam eine politische Haltung hat, dann besteht sie im Streben, eine Ordnung in der Welt zu errichten, die sich auf die Gerechtigkeit und den Frieden stützt. Der Islam verwendet nicht das Mittel der Gewalt zu diesem Zweck. Der Dschihad im Islam ist ein friedliches Bestreben. Die religiösen Quellen als unveränderlich anzusehen, ist eine Haltung, die zur Erstarrung des Islam führen und verhindern würde, ihn von seiner Entwicklungszeit im 7. Jahrhundert auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Darum muss diese Haltung überwunden werden. Und das geht nur, wenn man die Logik der Erneuerung (tadschdid) wirksam werden lässt. Das Wesen dieser Logik liegt in der Annahme, dass die Religion eine unveränderliche, absolute und universelle Seite hat, die aus den Grundsätzen des Glaubens, Betens und der Moral besteht, und eine veränderliche, historische Seite, die sich auf das Recht und die Politik bezieht.«
Folgendermaßen können die Ansichten von Hasan
Rachid al-Ghannouchi (geb. 1941) ist ein islamischer Denker, der in England im Exil lebt. Seine Gedanken wären wie folgt zusammenzufassen: »Was dem Islam widerspricht, ist nicht die Demokratie, sondern die Diktatur. Es ist unsinnig, dass einige Muslime die Demokratie bekämpfen. Die Muslime sollten eigentlich die Diktatur und den Totalitarismus bekämpfen. Daher sollten die Islamisten auch nicht die Demokratie, sondern eigentlich die Regime der Diktatur anklagen und in ihren Ländern für die Weiterentwicklung der bereits erzielten demokratischen Errungenschaften kämpfen. Es ist auch äußerst falsch, die Demokratie als ein Instrument zu betrachten, das man nach einer Weile abschaffen müsste. Die Demokratie ist im Wesen des Islam angelegt. Denn der Islam führte das System der Beratung (schura) ein, das von der westlichen Welt übernommen und zu einem System entwickelt wurde.
Wir müssen die Demokratie noch stärken, indem wir sie mit ethischen Werten bereichern. Der Kosmos ist nicht auf Feindschaft, sondern auf Liebe und Frieden gegründet worden. Es ist kein richtiger Gedanke anzunehmen, dass eine uralte Feindschaft zwischen dem Westen und dem Osten existiert, und es kann die Zukunft der Welt nicht positiv beeinflussen. Dieser Gedanke widerspricht dem Objektivitätsprinzip der Geschichte. Denn ein Blick in die Geschichte der Zivilisation zeigt uns, dass der Westen und der Islam eng beieinander gestanden haben. Beide haben ihren gemeinsamen Ursprung im Glauben Abrahams. Und beide haben sich das rationale Denken zur Grundlage gemacht. Diese beiden Zivilisationen sollten ihre althergebrachten Fehler nicht wiederholen, sondern sie revidieren und beginnen, den Weg des Dialogs anstelle des Konflikts einzuschlagen.«
Abdelwahab el-Affendi aus dem Sudan, der an der Universität London lehrt, skizziert in seinem Werk über die politische Philosophie folgendermaßen: »Der Kampf des Muslims muss Freiheit und Demokratie zum Ziel haben. Ein Staat, ob islamisch oder nicht, darf sich nur auf den freien Willen seiner Bürger stützen. Ein idealer Staat der Muslime hat pluralistisch und freiheitlich zu sein. Er darf seine nicht-muslimischen Bürger nicht als Bürger zweiter Klasse behandeln. Wenn die Diskussionen um die islamische Politik Schlüssigkeit besitzen sollen, so muss man den Begriff des islamischen Staates fallenlassen. Das eigentliche Ziel der Politik ist, die Menschen in Frieden zusammenleben zu lassen, und die Grundlage dafür bilden Gleichheit und Gerechtigkeit. Es muss betont werden, dass das Individuum, das seine Religion frei ausüben darf, hierfür eines Staates nicht bedarf. Al-Ghazali, Ibn Taymiya, Chomeini und ihre Nachfolger, die einen islamischen Staat für die Existenz eines islamischen gesellschaftlichen Lebens voraussetzen, propagieren eine Irrmeinung.«
Muhammad Ammara aus Ägypten, der in seinen Büchern oft Begriffe wie Erneuerung, Reform und freie Urteilsfindung (idschtihad) hervorhebt, schreibt in seinem Buch al-islam wa hukuk al-insan (Der Islam und die Menschenrechte) Folgendes: »Die nach der Französischen Revolution proklamierten und häufig geforderten Menschenrechte sind im Islam nicht einfach nur Rechte, sondern auch Aufgaben. Im Konflikt zwischen dem Staat und den Rechten sind die Rechte vorzuziehen. Denn sie sind die Daseinsberechtigung des Staates. Das Recht auf Ernährung, Wohnung, Sicherheit, Gedanken- und Glaubensfreiheit, Teilnahme und Kritik an der Regierung, Überwachung der Regierung usw. – das sind nicht einfach Rechte, sondern auch Pflichten für jeden Menschen. Der Islam garantierte den Menschen die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, indem er das Verbot des Glaubenszwanges einführte (Koran: 2/256). Im Islam ist die Beratung, d.h. die Teilnahme der Regierten an der Regierung, nicht nur ein Recht, sondern eine obligatorische Pflicht (fard) der Scharia. Viele Prinzipien des demokratischen Systems wie die Freiheit des Denkens und der Rede, Gleichheit, Überlegenheit des Rechts und Gerechtigkeit sind im Islam ebenfalls nicht einfach nur Rechte, sondern zwingende Pflichten (fard). Diese Rechte und Pflichten sind allesamt nur auf friedlichem Weg wahrzunehmen und zu erfüllen.«
Nun zu Philosoph Mohammed Abed al-Jabri (gest. 2010) aus Marokko, der mit seinen Arbeiten zur kritischen Auseinandersetzung mit den »Islamisten« Aufmerksamkeit erregte: »Der Prophet Muhammad hat sich niemals als politisches ›Oberhaupt‹ titulieren lassen, sondern er hat sich stets als ›Prophet‹ definiert. Er unterhielt Beziehungen zum Volk, die durch das Prinzip der Beratung (schura) geregelt waren. Die Regierenden erhalten die Befugnis zu regieren vom Volk und sie sind in erster Linie dem Volk verpflichtet. Wenn man das Gebot der Beratung im Koran (2/159 und 42/38) im Auge behält, ist die Verbindung der Verwaltungs- und Gesetzgebungsgewalt mit der Despotie und dem Zwang absolut unzulässig. Im Islam ist die Angelegenheit der Regierung nicht durch eindeutige, dogmatische Bestimmungen geklärt, wie es bei der Verehrung Gottes der Fall ist.
Der Islam hat keine bestimmte politische Regierungsform eingeführt, die für alle Zeiten gültig bleiben sollte. Er legte lediglich allgemeine Prinzipien fest (bezüglich des Glaubens, der Lebensführung, des Eigentums, Verstandes und Schutzes der Menschenwürde). Den Aufbau einer Rechtsordnung zur Befriedigung der jeweiligen Bedürfnisse der Gesellschaft hat der Islam den Menschen selbst überlassen. Daher ist der Islam seinem Wesen nach säkularistisch. Denn wir haben keinen Klerus. Da es im Islam keine mit der Kirche vergleichbare Institution gibt, besteht auch das Problem einer Trennung der Religion vom Staat nicht. Was unsere Gesellschaften brauchen, ist die Trennung der Religion von der Politik. Dies bedeutet, dass die Religion für politische Zwecke nicht instrumentalisiert werden darf; denn die Religion repräsentiert einen konstanten und absoluten Bereich im menschlichen Dasein. Die Politik hingegen ist relativ und veränderlich. Die Politik wird von Interessen geleitet, und das Bestreben der Politiker orientiert sich an Vorteilen. Die Religion muss aber fern von solchen Überlegungen gehalten werden. Wenn religiöse Konflikte von politischen Ambitionen herrühren, bedeutet dies für die Gesellschaft eine Zerreißprobe und kann zum Bürgerkrieg führen.«
İhsan Eliaçık (geb. 1961) aus der Türkei, der in seinen Schriften die bereits 14 Jahrhunderte währende Vergangenheit des Islam mutig hinterfragt, setzt der These des theokratischen Staates und dessen Antithese des laizistischen Staates eine neue Synthese entgegen, die er den »Staat der Gerechtigkeit« nennt. Seine Position, die er in seinem Buch Adalet Devleti – Ortak İyinin İktidarı (Staat der Gerechtigkeit – Die Herrschaft des gemeinsamen Guten) detailliert zur Sprache bringt, besagt zusammengefasst Folgendes: »Die Aufgabe, das Recht der Scharia nach dem letzten Propheten Muhammad zu erneuern, ist den Menschen überlassen worden. Die Muslime dürfen im Einklang mit den grundlegenden Zielen der Religion das Rechtssystem erneuern. Daher gibt es im Islam auch keinerlei politische Ordnung, die durch starre Schablonen festgelegt wäre. Das Wesen der politischen Philosophie im Islam besteht darin, einen Staat zu gründen, der sich auf Gerechtigkeit stützt. Welche Regierungsform im Lichte dieses grundlegenden Wertes zu bilden sei, müssen die Menschen durch ihre Vernunft selbst herausfinden.
Der Islam setzt sich aus Bestimmungen zum Glauben, zum Beten, zur Moral und zum Recht zusammen. Die Bestimmungen des Glaubens und des Betens sind nicht Sache des Staates; die universellen moralischen Bestimmungen sind die geistigen Grundlagen des Staates, während die rechtlichen Bestimmungen der Entwicklung der Gesellschaft zu überlassen sind. Parallel zum Wandel der Lebensbedingungen ändern sich auch die Rechtsbestimmungen (Scharia). Die Scharia, d. h. Recht, ist jeweils alles das, was Gerechtigkeit gewährleistet. Daher muss das z. Zt. weit verbreitete Scharia-Verständnis, das einen theokratischen Staat anstrebt, ersetzt werden durch eine innerliche Religiosität, die das moralische Wesen des Islam hervorhebt. Auch der Staat sollte von dieser moralischen Substanz der Religion nach Kräften profitieren. Der fundamentale Daseinsgrund des Staates ist die Herstellung dieser Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit, die jedem sein Recht gibt. Der Staat hat keine Religion, und das eigentliche Maß des Regierens ist die Gerechtigkeit; daher ist die Bezeichnung ›Staat der Gerechtigkeit‹ bzw. Rechtsstaat angemessener als Islamstaat.«
Des Weiteren leistete ein europäischer Staatspräsident einen wichtigen Beitrag: Alija Izetbegović (gest. 2003), ein moderater und aufgeklärter muslimischer Staatsmann mit einem soliden philosophischen Hintergrund und ein Erneuerer im Glaubensverständnis wie in der Staatsführung. Die erstmalige Wahl (1990) eines islamischen Reformers in einem Land mit muslimischer Bevölkerung in Europa lenkte die Aufmerksamkeit des Westens wie auch der islamischen Welt auf Bosnien. Mit Izetbegović sollte zum ersten Mal in Europa das Staatsverständnis eines muslimischen Staatschefs in die Praxis umgesetzt werden.
Sobald er die Macht angetreten hatte, wurde seine Regierung sozusagen per Knopfdruck vor eine Kriegssituation gestellt, was für einen neugegründeten Staat das größte aller Probleme darstellt. Seine Vision hatte ihn im ehemaligen Jugoslawien hinter Gitter gebracht, und er musste jetzt durch eine Prüfung gehen, in der er die Werte, für die er in Friedenszeiten bestraft worden war, im Krieg als muslimischer Staatsmann vertreten musste. Denen, die viel Aufhebens um Bosnien als islamischen Staat mitten in Europa machten, entgegnete Izetbegović gleich zu Beginn seiner Amtszeit Folgendes: »Wir fordern keinen islamischen Staat. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass der Islam respektiert wird und dass die Muslime mit anderen ethnischen Gruppen zusammen in Freiheit ihren Glauben praktizieren dürfen.« Er konnte jetzt aber nicht mehr an seiner Theorie feilen, sondern es war Zeit, sie anzuwenden.
Dieser Europäer, der sich als Staatsmann die Sympathien von Freund und Feind, von Ost und West zu sichern wusste, verteidigte ein Modell der Zusammenarbeit zwischen Glauben und Staat, wie es in Deutschland der Fall ist. Izetbegović war ein Staatsmann, der die Politik von ethischen Werten und nicht von religiösen geleitet wissen wollte, worin er Konrad Adenauer glich. Er forderte die Gleichberechtigung für Muslime, Katholiken, Orthodoxe und Juden. Er hat nie den Vorwurf eines christlichen Terrors erhoben, auch dann nicht, als junge Freischärler in von Priestern gesegneten Aktionen Moscheen bombardierten und Frauen vergewaltigten. Izetbegović verbot es, Grausamkeit mit Grausamkeit zu vergelten. In seinen Reden noch während des Krieges verlangte er mehrfach, dass man die Zivilbevölkerung und Kirchen nicht angreifen, Frauen und Kinder nicht belangen, sich am Allgemeingut und an den Kulturschätzen des Landes nicht vergreifen darf und dass die bereits unterschriebenen Verträge eingehalten werden müssen.
Als der blutigste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg nach dreieinhalb Jahren zu Ende war, willigte Izetbegović im Namen des Friedens einer ungerechten Neuverteilung des Territoriums ein und forderte die muslimische Bevölkerung auf, keine Rache an den Übeltätern zu üben, sondern das Land mit den anderen zusammen wiederaufzubauen und die Wunden des Kriegs heilen zu lassen. Als Jurist wirkte er an der Vorbereitung der Verfassung Bosniens mit und setzte sich für die Gleichberechtigung aller Ethnien hinsichtlich des Glaubens und der Sprache ein. Und das tat er nicht etwa aus Zwang, sondern weil er als überzeugter Anhänger des Rechtsstaates die Freiheit, das Recht und die demokratische Ordnung zu den Grundfesten des Islam zählte.
Die hier angeführten Beispiele, d.h. die Theorien und die politische Praxis aufgeklärter und demokratischer muslimischer Denker zeigen Folgendes: Eine Politik mit islamischer Weltanschauung bedeutet Einsatz und Bestrebung für Menschenrechte, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Toleranz und Modernität.
Nicht-muslimische Demokraten und demokratische Muslime sollten zusammen gegen die Kräfte arbeiten, die mit unfairen Verleumdungskampagnen die Gesellschaft verunsichern und einen Keil zwischen Muslime und Nicht-Muslime treiben wollen. Wer dem Glauben nach Muslim und der politischen Ansicht nach Demokrat ist, muss einerseits immer wieder die Gleichheit gegen Diskriminierung, den Rechtsstaat und die Freiheit gegen Repressionen, den Pluralismus gegen Monokultur, die Liebe gegen den Hass, den Dialog gegen Ausgrenzung propagieren, und er muss andererseits sein Engagement gegen eine Instrumentalisierung der Religion (egal welche) durch die Politik verstärkt fortsetzen.
Quelle: Benjamin Idriz: „Grüß Gott, Herr Imam! Eine Religion ist angekommen“, Diedrichs-Verlag München 2010,